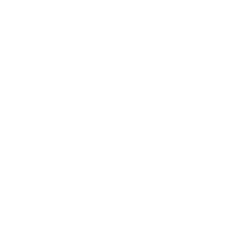Die Freude von Zufallsfunden. Gerade habe ich einen Brief einer französischen Brieffreundin aus dem Jahr 2006 zufällig hinten in einem alten Adressbuch gefunden. Dieser Brief ergänzt einen Fund von vergangenem Jahr: eine Box mit Zetteln und Briefen vom Anfang der 2000er. An den Briefen scheint die eigene Jugend zu heften, bzw. deren Milieu – da ja nur die Worte der anderen, die Antworten auf das eigene Erhalten ist. Aus ihnen spricht viel Liebeskummer und Unsicherheit, wer man ist; die Suche nach Bestätigung und Anerkennung. Aber auch viel Langeweile: in der Schule, zu Hause, bei Hausarrest.
Bei weiter weg wohnenden Freunden waren die Briefe die freie Alternative zu den Ferngesprächen, die nur über Telefonapparate geführt werden konnten, die letztlich unter der Kontrolle der Eltern. Stand das Telefon im Wohnzimmer, waren diese nicht selten in Hörreichweite. Versuche, die Eltern als Zerberusse der Fernkommunikation zu umgehen, rächten sich spätestens bei der nächsten Telefonrechnung, die sorgsam auf die Quelle von Kostenschwankungen überprüft wurde.
Briefe wurden aber auch im Nahraum geschrieben, dort, wo die Empfänger leicht zu erreichen gewesen wären, wo geschriebenes und gesprochenes Wort ein Hybride ungleichzeitiger und gleichzeitiger Kommunikationen generierte. Entlastet von der vollen Verantwortung zu beschreiben, wie das Leben gerade insgesamt zu spielte, waren diese Briefe oft profaner. Viele schrieb man aus dem Unterricht heraus, der ja letztlich einen nicht unwesentlichen Teil der (fremdbestimmten) Tageszeit ausmachte: Klagen über Langweile, Berichte über Geschehenes, besonders die Missetaten anderer, Verabredungen, auch Schmeicheleien.
Während die Fernbriefe auf die offizielle postalische Infrastruktur angewiesen waren, gab es für diesen Schriftverkehr eine informelle und dezentrierte Zirkulationsordnung, ein analoges smtp-Protokoll. Die Briefe wurden vertrauenswürdigen Freunden mitgegeben, bei denen man die begründete Vermutung hatte, dass sie die Empfänger*in früher treffen würden – manchmal wurden sie auch zur Abkürzung an weitere Mittelsfrauen weitergereicht. Nicht selten letztlich dann aber auch doch selbst übergeben. Kombiniert wurde das autonome Distributionssystem mit Brieffaltfertigkeiten, die wie Überbleibsel frühneuzeitlicher Briefpraktiken wirken. Umschläge waren rar, das Papier des Schreibblocks war sich selbst Umschlag. Routiniert wusste man wo das Blatt unbeschrieben gelassen werden musste, um nach dem Falten nur die Empfänger*in zu offenbaren.
Wenn mich solche Briefe mit einer gewissen Sentimentalität erfüllen, dann weniger als kulturkritische Verlusterfahrung. Inhaltlich und ausdrucksmäßig wird sich das Geschriebene – insbesondere bei den ‚Nahbriefen‘ – in seiner Belanglosigkeit kaum von heutigen Direktnachrichten unterscheiden. Hier wie dort geht es häufig vermutlich mehr um phatische Kommunikation, nicht um das, was gesagt wird: um die Anerkennung, die bereits in der Tatsache, adressiert zu werden, gegeben ist. Das bezaubernde an diese Briefen ist vermutlich vielmehr ihre residuale Materialität, die die zeitgenössischen Kommunikationsabsichten und -funktionen überlebt. Was der juvenilen Kommunikation von heute verlustig geht, ist die Chance auf den Zufallsfund, das Stolpern über die eigene Vergangenheit, die eigene vergangene Welt, durch solche belanglosen Briefe, die sich in vielen Ritzen, Schubladen, Kisten der Kinderzimmer verstecken können – und die einem mit gewissere Verwunderung die Welt der eigenen Vergangenheit gerade auch in den so leicht vergessenen Belanglosigkeiten wachrufen.