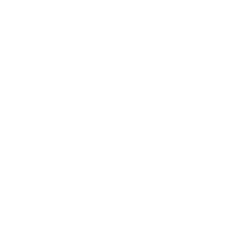Silke van Dyk et al. problematisieren in ihrem als fiktives Gespräch inszeniertem Beitrag über das „Jenseits des Diskurses“ eine dichotomische Entgegensetzung von Diskursivem und Nicht-Diskursivem. Diese sei in der CDA, etwa bei Norman Fairclough, zu finden, die den Diskurs in einen vorgängigen Realität der Klassengesellschaft verortet. Aber auch die Dispositivanalyse nach Bührmann und Schneider tendiert zu einem Dualismus, indem dem Diskurs allerlei Nicht-Diskursives Beigestellt wird (van Dyk et al. 2014: 348, 354 f.).
Dabei wollen van Dyk et al. aber auch nicht ein schlichtes „Alles ist Diskurs“ gelten lassen. Sie unterscheiden zwei Positionen. Eine „Diskursontologie“ – diese geht tatsächlich davon aus, dass alles Seiende diskursiv konstituiert sei. Dagegen setzen sie eine „Diskursimmanenz“, die ein epistemologisches Argument macht, und kein ontologisches – alles Seinende ist, insofern für uns bedeutsam gegeben, diskursiv vermittelt.
„Im Unterschied zu ‚Diskursontologie‘ meint ‚Diskursimmanenz‘ sozusagen ‚nur‘, dass uns die Dinge, insofern sie eine Bedeutung haben, nicht vordiskursiv zugänglich sind. Unser Zugriff auf sie, beziehungsweise unsere Erfahrung ihrer Existenz, kann also durch Bezeichnung, also diskursimmanent – im Sinne von: im Diskurs beziehungsweise dem Diskurs innewohnend – ausgewiesen werden. Wo die Diskursontologie behauptet, es gebe gar keine Welt außerhalb des Diskurses, sagt die Diskursimmanenz nur, dass diese Welt uns nicht zugänglich ist. […]
Die Verwirrung liegt in den unterschiedlichen Verwendungen des Begriffes nicht-diskursiv. Manche AutorInnen meinen damit das, was wir gerade diskutiert haben, also die Annahme, dass es ein uns nicht zugängliches Sein gibt. Und andere meinen damit ganz konkret Dinge oder Praktiken, die nicht sprachliche oder semiotische Artefakte sind. Dieser Verwirrung wäre aus meiner Sicht vorzubeugen, wenn wir auf die Bezeichnungen ‚außer-diskursiv‘ oder gar ‚nicht-diskursiv‘ ganz verzichten würden. Bruno Latour hat diese für uns nicht existente , nicht konstituierte Welt ‚Plasma‘ genannt; Salvoj Žižek greift auf Lacan zurück und nennt etwas Ähnliches das ‚Reale‘.“ (van Dyk et al. 2014: 352)
Über diese Unterscheidung hinaus scheint mir aber auch eine pragmatische Dimension bedeutsam zu sein: was machen Forscher*innen, wenn sie sagen, dass sie Diskursives untersuchen? Aus einer solchen Perspektive wird sichtbar, dass die genannte „Verwirrung“ nicht nur den Kritiker*innen anzulasten ist, die sich gegen einen allumfassenden Diskursbegriff wenden: häufig wird empirisch auch bei diskursimmanent begründeter Diskursanalyse, etwa im Gefolge Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes, praktisch mit im engeren Sinne sprachlichem Material gearbeitet. Es geht hier ganz sicher um eine Differenz innerhalb der Intelligibilität, die immer schon semiotisch und also diskursiv überformt sein mag und keine absolute Nicht-Diskursivität reklamieren kann, deren ‚Seiten‘ aber dennoch in der Praxis der empirischen Forschung eine differente Handhabung erfordern. Für eine solche pragmatische Differenzierung bieten van Dyk et al. ebenfalls einen Fährte an, wenn sie von Graden der Sedimentierung sprechen, durch die die „unterschiedliche Zählebigkeit von material-zeichenhaften Entitäten“ beschrieben wird (van Dyk et al. 2014: 354). Hier ließe sich auch an Wittgensteins nicht-dichotomes Verständnis von Gewissheit und Zweifel anschließen, bei dem Gewissheit nicht substanziell vorausgesetzte Unbezweifelbarkeit darstellt, sondern vielmehr relational hervorgebrachte und verfestigte Nichtbezweifelung, die in jedem konkreten Zweifel vorausgesetzt werden muss – selbst aber prinzipiell jederzeit wieder zum Gegenstand eines spezifischen Zweifels werden kann (vgl. Wittgenstein 1984).
Entscheidend ist dabei, anzuereknnen, dass eine diskursanalytische Studie für eine spezifische Fragestellung auf Sachverhalte zurückgreifen kann, ohne diese in ihrer diskursiven Konstruktion herauszuarbeiten, sie damit aber keinesfalls die grundsätzliche und unabänderliche Vordiskursivität dieser Sachverhlate behaupten zu muss. Vielmehr wird es unter einer anderen Fragestellung nicht nur möglich, sondern notwendig sein, die Bedeutungsdimension, die sprachliche und semiotische Konstitution des forschungspragmatisch als nicht-diskursiv Genommenen, etwa des Klassenantagonismus, herauzuarbeiten.
Dies impliziert in gewisser Weise aber auch ein forschungsethisches Bewusstsein, das die Befürchtung betrifft, dass die Deklaration eines Aspekts der Forschung als nicht-diskursiv, diesen „Gegenstand naturalisiert und ihm eine Aura des Nicht-Kontingenten und damit Nicht-Hinterfragbaren verleiht“ (van Dyk et al. 2014: 534). Freilich lassen sich Fragen bezüglich der in dieser Aussage implizierten Annahmen stellen: etwa dass das Diskursive als Dimension der Kontingenz gesehen wird, während das Nicht-Diskursive und Materielle als Dimension einer unhinterfragbaren Substanzialität verstanden wird. Auch die allgemeine politische Präferenz für Kontingenz lohnt ihrerseits noch einmal hinterfragt und relativiert angesichts diverser politischer Erwägungen relativiert zu werden. Nichtsdestotrotz verweist die Kritik auf ein Problem, das im Zuschnitt der Fragestellung, aber auch im empirischen Forschungsdesign berücksichtigt werden muss. Die Entscheidung, was in der Untersuchung eines diskursiven Gegenstandes vorausgesetzt wird, ist nicht unschuldig und muss sich der kritischen Befragung stellen. Beispielsweise kann berechtigt problematisiert werden, was an sozialer oder natürlicher Geschlechtlichkeit vorausgesetzt wird, wenn etwa Redeverhalten nach Geschlecht klassifiziert und verglichen wird – ohne dass eine solche Untersuchung damit per se abzulehnen wäre. Eine Problematisierung spezifischer Voraussetzungen des Diskurses übersetzt sich forschungspragmatisch aber keinesfalls einfach in die Zurückweisung jeder Voraussetzung. Eben dies macht, der Form nach, ja Wittgenstein deutlich, wenn er auf die dem Zweifel zugrunde liegende Gewissheit verweist, ohne diese in den Rang eines apriorischen Wissens zu erheben. Nicht alles als ‚nicht-diskursives‘ Behandeltes ist dabei automatisch forschungsethisch oder gar politisch zu problematisieren. Vielmehr setzt die Problematisierung der Diskursivität von vermeintlich Nicht-Diskursiven selbst wiederum Voraussetzungen voraus – auch hier wieder Wittgensteins Argument. Versteht man die Differenz von Diskursivem und Nicht-Diskursivem nun nicht ontologisch und auch nicht allein epistemologisch, sondern als einen forschungspragmatischen umgang mit dem sozio-materiellen Phänomen der Sedimentierung, so hilft dies den Blick auf das forschungsethisch dringliche Problem zu richten, nämlich, was der Forschungsprozess macht: was er in seiner diskursiven Hervorbringung ausweist und was er diesem Blick entzieht.
Während die vorgeschlagene Perspektive hilft sich diesem Problem zu stellen, lehnt sie den Anspruch seiner ‚allgemeinen‘ oder ‚konzeptionellen‘ Lösung ab. Wo eine solche ‚Lösung‘ Forschung als konkrete Praxis von der Auseinandersetzung mit Problem der Perspektivierung zu entlasten vorgibt, plädiere ich hingegen dafür, dieses im spezifischen Zuschnitt und Vollzug der Forschungstätigkeit zu reflektieren. Als gesellschaftliche Praxis hat Diskursforschung Teil an der Sedimentierung und ‚Kontingenzialisierung‘ der Soziomaterialität. Sowenig wie sie sich dieser Immanenz im Politisch-Sozialen entziehen kann, so wenig kann sie sich dieser aber auch einfach unumwunden einfügen.
In dem hier vorgeschlagenen Verständnis ist die Differenz von Diskursiven und Nicht-Diskursiven dem Forschungsprozess nicht vorgängig, sondern muss in diesem Selbst verhandelt werden – nicht als ontologische oder epistemologische Differenz, sondern als ein Marker von Umgangsweisen mit Aspekten des Forschungsgegenstands. Dabei ist die Grenzziehung nicht zuletzt vor dem Hintergrund forschungsethischer und politischer Problematisierungen rechenschaftspflichtig, die ihrerseits kontingent und historisch wandelbar sind. Die forschungspragmatische Unumgänglichkeit der Behandlung von Aspekten des Gegenstands als ‚Nicht-Diskursivem‘ befreit nicht von deren diskursanalytischer Hinterfragung, sondern macht sie – ganz im Gegenteil – allererst als spezifische dringlich.
Literaturangaben
van Dyk, S., Langer, A., Macgilchrist, F., Wrana, D., Ziem, A. (2014): Discourse and beyond? Zum Verhältnis von Sprache, Materialität und Praxis. In Angermuller, J., Nonhoff, M., Herschinger, E., Macgilchrist, F., Reisigl, M., Wedl, J., Wrana, D., Ziem, A. (Hrsg.): Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Bielefeld: transcript, 347–363.
Wittgenstein, Ludwig 1984: Über Gewißheit, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.