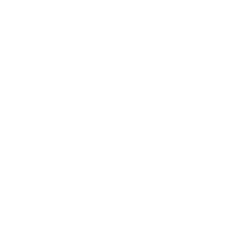Angesichts des neuen Joker-Films von Todd Phillips wird vor der Gefahr gewarnt, die Darstellungsweise des Films könne Gewaltnachahmungen stimulieren. Besonders in der USA werde diskutiert, so Holger Heiland in seiner Rezension aus der Jungle World, „ob der Film gar eine Welle von ‚incel violence‘ auslösen könne“, also Gewalt von misogynen Gruppen von jungen Männern, die ihre Jungfräulichkeit und eine gefühlte Ablehnung durch Frauen als Ausgangspunkt von Verschwörungs- und Gewaltphantasien – und immer wieder auch: Gewaltakten – nehmen.
„Gefährliche Filme“ haben eine eigene Geschichte – in der Stanley Kubricks (erzwungene) Verbannung von A Clockwork Orange vom britischen Markt sicher einen besonderen Platz einnimmt, wurde in diesem Zusammenhang doch die direkte Nachahmung von filmischer Gewalt diskutiert. Dabei scheint der Inhalt des Films, seine Botschaft, ohnmächtig gegen seine Ästhetik zu sein. Das ist unter anderem in der Diskussion um „Antikriegs-Filme“ deutlich geworden, deren Gewaltdarstellung sich gegenüber der intendierten – oder zumindest verlautbarten – Wirkungsabsicht verselbstständigt, wie u.a. Paul Goetsch problematisiert hat (Goetsch 1997). Aber auch die wiederholte Nachstellung eines Mordes aus American History X ist ein trauriges Beispiel für die Entkopplung filmischer Gewaltdarstellung von ihrem narrativen Kontext.

Die Angst vor der Folgen von Filmen verweist auf eine allgemeine Ambivalenz der Kunst in Hinblick auf ihre Wirkung, die im Massenkino nur in zugespitzter Form auftritt. Kunst sieht sich einerseits dem Anspruch ausgesetzt, gesellschaftlich „relevant“ zu sein. Diese Relevanz kann Kunst aber nicht ausgehend von einer eindeutigen Botschaft haben (dann wäre sie Wissenschaft oder Propaganda), sondern durch die Freiheit zum „Spiel“, zum Tastenden und Vorläufigen, in dem man sich irren darf, die Freiheit zur experimentellen Erschließung des Möglichen. Diese Freiheit erschließt sich Kunst allerding nicht zuletzt auch über eine Entlastung von Wirksamkeit. Trivial mag es wirken, dass man für einen Mord auf der Bühne nicht verhaftet wird – handelt es sich doch schlicht um einen gespielten Mord und nicht um Mord. Heikler wird es bereits bei einer Beleidigung oder Drohung auf der Bühne. Denn diese ist nur deshalb keine ‚wirkliche‘, weil die Zuhörer*innen um die fiktionalisierende Rahmung wissen. Der Akt selbst unterscheidet sich – anders als der gespielte Mord – in seinen Einzelheiten nicht. Zuletzt nimmt Kunst aber auch noch einen weiteren Bruch zur gesellschaftlichen Wirklichkeit in Anspruch: aus ihr ergeben sich keine unvermittelten Forderungen und Handlungsanweisungen. Es kann Kunstwerken vor diesem Hintergrund durchaus zugutekommen, dass sie wenig beachtet werden, dass sie lediglich in Nischen existieren. Dies erlaubt bisweilen eine stärkere Rahmung der Rezeption, die eine gewisse Wirksamkeitskontrolle ermöglicht.
Das Massenkino sieht sich dagegen mit einer unkontrollierten Rezeption konfrontiert. Der Einwand, dass der Film Kunst sei und darum keine Wirklichkeit, liest sich daher eher als ohnmächtig; er verwechselt ein Sollen mit einem Sein – insoweit es nicht schlicht um die Zurückweisung der Verfolgung der inszenierten Tat als wirkliches Verbrechen geht. Die Unwirksamkeit der Kunst, als Ermöglichungsgrund ihrer Freiheit und damit ihrer Wirksamkeit, lässt sich nicht einfach dekretieren.
Vor dem Hintergrund der paradoxalen Rolle, die der Wirksamkeit der Kunst zukommt, kann es nun nicht einfach eine Auflösung zu einer Seite hin geben. Wenn man Kunstwerke auf ihrer erwartete Wirkung festlegen wollte, so hieße das tatsächlich das Ende der Kunst. Sie könnte sich nur noch in den etablierten Maschen des gesicherten (und sicheren) Wissens bewegen. Zugleich greift es zu kurz, die Problematisierung spezifischer Werke mit dem prinzipialistischen Verweis auf den entkoppelten Status der Kunst abzuwehren. In dieser Abwehr verleugnete sich die Kunst ihrerseits selbst, insofern sie ihre Legitimität aus ihrer Irrelevanz zöge.
Literatur
Goetsch, P. (1997): Der unsichtbare Feind im Vietnam-Film. Zum Problem der Sympathielenkung. In Charlton, M., Scheider, S. (Hrsg.): Rezeptionsforschung. Theorien und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 148-156.
Heiland, Holger 2019: Incel Inside, dschungel #41, S. 2–5.