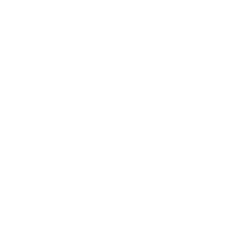Gegenwärtig gibt es einen emotional aufgeladenen Diskurs um den Umgang mit Social Distancing. Einerseits kann eine moralisierende Abwertung „unsolidarischer“ Nah-Sozialität ausgemacht werden, andererseits wird auch wiederum die Reaktion auf diese kritisiert, in dem z. B. eine Tendenz zur Denunziation ausgemacht wird. In diese Wiedersprüche fühle ich mich selbst unmittelbar versetzt. Immer wieder ärgere ich mich. Bei Menschen, die meine Bemühungen Abstand zu halten mit der konsequenten Nutzung der Mitte des Bürgersteigs quittieren – so dass ich im Zweifel auf die Straße ausweichen müsste. Bei der Beobachtung einer kleineren Gruppe grillender Menschen – während ich selbst mir am Oster-Wochenende einen Besuch bei meiner Mutter versage. Ich möchte diese emotionale Selbstbeobachtungen als Anlass für ein paar Grundlegende Überlegungen zur Psychodynamik des Social Distancing nehmen, die uns wohl noch einige Zeit begleiten wird.
1. Social Distancing erzeugt Frustration.
Das mag trivial klingen. Wenn man aber davon ausgeht, dass – gleich ob für eine Verhinderung einer weitereichenden Infektion oder ‚nur‘ für deren ausreichende Verlangsamung – eine langfristige Einschränkung unserer Sozialkontakte erwartet werden muss, so ist es keine unerhebliche Frage, wie mit dieser Frustration umgegangen wird. Dabei sind zwei Quellen der Frustration zu unterscheiden. Die eine liegt in der gesteigerten Intensität des Kontaktes zum nächsten Umfeld: der Partner*in, den Familienangehörigen und Mitbewohner*innen – gerade auch in Wohnsituationen wo diese nicht freiwillig gewählt wurden. Einerseits intensiviert der erzwungene Dauerkontakt bestehende Konflikte. Andererseits verringert die Gelegenheiten sich Konflikten und Übergriffen zu entziehen. Hier ist in den letzten Wochen schon viel von sozialen Einrichtungen gewarnt worden, dass ein Anstieg von häuslicher Gewalt und von Missbrauch befürchtet wird. Daneben tritt die Frustration die sich direkt und indirekt aus der Vermeidung von Kontakten ergibt. Die direkte Vermeidung von Kontakten frustriert emotional, wenn etwas das Bedürfnis nach dem ungezwungen Zusammensein bei einem Familientreffen, einem Gemeinsamen Kneipenabend, einem gemeinsamen Spaziergang mit Freunden nicht erfüllt werden kann. Indirekt wirkt hier etwa eine Einschränkung von Konsummöglichkeiten, in der wir uns eher in serieller Nähe befinden. Ob dies nun einfach die unbeschwerte(re) Fortbewegung im öffentlichen Raum ist, der Theaterbesuch, der Besuch eines Punkfestivals oder das (wohl schon legendäre) Grillen im Park. Dies sollte nicht mit einem Ende der Konsumorientierung verwechselt werden, wie sie bisweilen – man muss wohl sagen: zynisch – herbeigewünscht wird. Gibt es in der indirekten Form Einschränkungen eines konsumistischen Hedonismus was den kollektiven Erlebniskonsum anbelangt (zu dem eben auch der Theaterbesuch gehört, insofern er auf die performative Einzigartigkeit zielt), so wird mit der direkten Kontaktvermeidung doch auch gerade der Bereich eines konsumarmen Hedonismus eingeschränkt – etwa dem geselligen Abend oder das Abhängen an der Tanke mit Freunden. Vor diesem Hintergrund ist eher von einer Ausdehnung des Individualkonsums auszugehen. Indikatoren könnten dabei die nicht stillstehenden Lager der Versandunternehmen ebenso wie die Videoaufrufe bei Netflix oder auch Pornhub sein. Inwiefern ein solcher Konsum Kompensation für die bisher vor allem als Einschränkung und Entsagung wahrgenommenen Veränderungen sein kann, ist fraglich. Offen bleibt also einerseits die Frage, wohin mit dem Frust, und vermutlich wichtiger noch: welche Bereiche der konsumarmen Freude können erschlossen werden, um ihm etwas entgegen zu setzen.
2. Die Frustrationsursache entzieht sich – und so richtet sich Aggression auf Ersatzobjekte.
Geht man zunächst von einer kollektiven Frustration durch das Social Distancing aus, so ist sozialpsychologisch für unsere Fähigkeit mit diesem umzugehen, wohl nicht unerheblich, dass die Ursache, die zu unseren Frusterfahrungen führt, nicht greifbar ist. Wir wissen zwar, dass es Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen einer Pandemie sind, und die Bilder aus Krankenhäusern in Italien, von militärisch abtransportierten Leichen in Spanien und von Massengräbern für die nicht von Angehörigen bestatten Leichen in New York gehen uns nahe. Sozialpsychologisch ist es bei all dem jedoch eine der bestetablierten Erkenntnisse, dass kognitives Wissen um Zusammenhänge, emotional wenig zu melden hat. Die Aggressionstheorie hat sich in den letzten Jahrzehnten an vielen populärpsychologischen Verallgemeinerungen abgearbeitet. Man kann wohl aber feststellen, dass Aggression zwar nicht die einzige, aber eine der wichtigsten Arten- und Weisen ist, Frustration zu verarbeiten. Eine gewisse instrumentelle Rationalität hat dieser Zusammenhang, wenn Aggressivität als ein Modus der Beseitigung von Frustrationsursachen, also den Gründen der Freud- oder Lustversagung, verstanden wird (womit nichts über die Angemessenheit oder moralische Akzeptabilität dieser Reaktion gesagt ist). Nun ist der einer Aggression – als Verhalten – zugrunde liegende emotionale Zustand des Ärgers, dadurch gekennzeichnet, unspezifisch transitiv zu sein: Die Aggression sucht sich ihr Objekt. Und wenn man davon ausgeht, dass Covid-19 in seiner vermittelten Omnipräsenz sich dieser Objektsuche weitgehend entzieht (es ergibt wenig Sinn, böse auf das Virus selbst zu sein), so liegt es nahe, dass sie ich auf andere, verfügbarere Objekte richtet. Drei bieten sich hier besonders an:
Die Regierung – als Instanz der Festsetzung und Durchsetzung von Einschränkungen im Alltagsleben, kann sie leicht als eine anschaulichere – wenn auch immer noch abstrakte – Ersatzursache fungieren, auf die sich die Aggression richtet. Bedarf es einer größeren Konkretion, kann es zu Personifizierung der Regierung kommen. Hier bietet sich in Deutschland die Regierungschefin Angela Merkel an – zumal in Teilen ja bereits anderweitig eingeübt worden ist, sie als Quell und Inbegriff allen gesellschaftlichen Übels zu fassen.
Zweites mögliches Aggressionsobjekt sind – klassisch, sozusagen – die Akteure, die auf die Gefahren des Virus’ hinweisen und entschiedendes Handeln anmahnen. Mit der Botschafter*in will man sich hier gewissermaßen das Berichtete und seine Konsequenzen vom Hals halten. Hier stehen insbesondere die sogenannten „Expert*innen“, die medial im Zuge der „Corona-Krise“ einen großen Stellenwert bekommen haben, eine entscheidende Rolle. Dabei können die Differenzen, die sich zwischen wissenschaftlichen Positionen finden lassen, genutzt werden, um unerwünschten Einschätzungen abzuwehren, in dem ihrer Träger*in eine Manipulation der Öffentlichkeit aufgrund von niederen Motiven zugeschrieben wird.
Einer dritten Gruppe möglicher Ersatzobjekte für die entstehende Aggressionen möchte ich noch etwas ausführlicher behandeln.
3. „Unsolidarische“ Akteure bieten eine besonders geeignetes Ersatzobjekt für Aggressionen. In die Reaktion auf sie mischt sich Frustrationsbewältigung.
„Unsolidarische“ Akteure – also Menschen, die etwa Abstandsregeln im Supermarkt ignorieren, um sich schnell durchzudrängeln, oder solche, die sich „von Corona“ nicht den großen Partyabend kaputt machen lassen wollen – sind im Alltagshandeln leicht auszuamchen: sie sind präsenter als sowohl Regierung als auch Expert*innen. Zum einen kann ihnen gegenüber Neid empfunden werden, für die Bedürfnisbefriedigung, die sie sich zugestehen, zu der man sich selbst – aus moralischen Handlungsabwägungen oder Angst – nicht in der Lage sieht. Zum anderen können sie moralisch abgewertet werden, da ihr Verhalten nicht nur „unsolidarisch“ in dem Sinne ist, dass sie sich an den Kosten des kollektiven Gutes (also der Sicherstellung eines medizinisch bewältigbaren Ansteckungsverlaufs) nicht beteiligen, sondern letztlich unmittelbarer als mögliche Überträger des Virus auch konkret ihre Mitmenschen gefährden.
Mit diesen Ausführungen soll gar nicht grundsätzlich bestritten werden, dass es gute Gründe geben kann, erbost über das Verhalten dieser Menschen zu sein. Und eine gewisse soziale Sanktionierung gehört zweifelsohne zur Durchsetzung sozialer Normen, gerade da, wo sie sich nicht auf den Gesetzestext und den repressive Staatsapparat beschränken können. Geht man von der oben genannten Grundsituation aus, so ist allerdings zu vermuten, dass sich hierrein immer auch eine – aus der von Social Distancing mit sich gebrachten Frustration erwachsende – Aggression mischt. Und das bringt durchaus eine gewisse Gefahr mit sich, da es zu einer Aufladung der Haltung gegenüber „Regelverstößen“ fürht, die sich im Verhalten eskalativ niederschlagen und letztlich zu Gewalt führen kann.
Das heißt – zunächst einmal ganz von sich selbst aus gedacht –: Man sollte seine eigene Reaktion auf das Verhalten anderer zuweilen darauf zu befragen, inwieweit ihr nicht eine allgemeine Frustration und Gereiztheit zugrunde liegt. Dies ist natürlich nur sehr bedingt möglich: sowohl weil uns die Energie fehlt, unser Verhalten in seinem Vollzug beständig mitzureflektieren als auch darum, weil uns die Quellen und Motivationen unserer Empfindungen und unserer Tuns keinesfalls ohne weiteres verfügbar sind – sie stellen jedenfalls kein einfach zu ergründenden Letztgrund dar. Statt kompensatorischer Aufklärung und Reflektiertheit bedürfte es, meine ich, weitergehend des Versuches, einer proaktiven positiven Gegenbewegung hervorzubringen.
4. Es bedarf Bemühungen um eine positive Beziehung zum Social Distancing die emotional nachvollziehbar ist und der Entwicklung neuer konsumarmer Formen der Freude und Lust.
Die Frage ist, wie in Zeiten des Social Distancing Freude und Lust ausgelebt und entwickelt werden können – wie also der Frust grundlegend abgeschwächt werden kann. Ein erstes Moment einer solchen Gegenbewegung ist, sozusagen in Umkehr der moralischen Abwertung der Regelbrecher*innen, die moralische Gratifizierung der Einhaltung des Social Distancing. So ist etwa auf Twitter nachzulesen, wie sich Menschen in ihren Versuchen, Kontakte möglichst zu reduzieren nahezu anfeuern. Und auch, wie sie sich dafür loben, gute Menschen zu sein. So wichtig es ist, ein positives Verhältnis zu schwerfallenden neuen Verhaltensmustern zu gewinnen, und entsprechendes Verhalten kollektiv anzuerkennen, so wenig ist damit zu rechnen, dass eine positive Moralisierung langfristig hinreicht. Sie hat sicher den Vorteil, schnell einsetzbar zu sein und ihr kommt somit eine wichtige Funktion beim Verhaltenswandel zu. Allerdings ist wahrscheinlich, dass sie ihre Kraft insbesondere dann schnell abnutzt, wenn sie neben dem recht manifesten Nutzen derjenigen steht, die sich in ihrem Verhalten nicht einschränken lassen. Anzunehmen ist dann, dass die moralische Wertigkeit eines distanzfreundlichen Verhaltens zwar gedacht werden kann, aber emotional kaum noch ankommt und so auch wenig handlungsmotivierend wirken kann.
Die oben genannte Befriedigung über Konsum, wird eine große Rolle spielen. Sie ist sicher nicht einfach zu verteufeln. Allerdings wird auch sie nur einen kleinen Teil der Frustration auffangen können. Dabei ist fragwürdig, inwiefern sie die sozialen Bedürfnisse des Menschen aufzufangen vermag – inwiefern sie in dieser Hinsicht mehr als ein Frustrationsaufschub sein kann.
Entscheidend wird meines Erachtens aber sein, inwiefern es gelingt, im Laufe des Jahres weitere konsumarme Formen der Befriedigung emotionaler und sozialer Bedürfnisse zu erfinden. Es bleibt offen, wie diese aussehen können. Und sicher ist hier nicht von einer einheitlichen „Lösung“ auszugehen – vielmehr werden solche Formen so vielfältig sein wie die Bedürfnisse und ihre Träger selbst. Nimmt man eine Psychodynamik an, wie ich sie für die Rahmenbedingungen des Social Distancing geschildert habe, so folgt draus jedoch: Es reicht nicht aus, sich zurückzulehnen und abzuwarten, wie und ob sich neue Kommunikationsfomen und neue Sozialitäten auf der Basis vergrößerter Distanz herausbilden – stattdessen bedarf es eines aktiven Suchprozesses, eines Experimentierfelds zur Entwicklung von Freude und Lust.