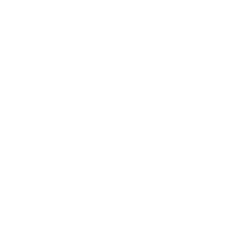Im Gefolge der Postmoderne ist es heute üblich, auf die Fragmentiertheit und Brüchigkeit des Selbst hinzuweisen. Dies ist zunächst einmal deskriptiv durchaus angemessen. Die Kritik des geschlossenen und einheitlichen Subjekts hat durchaus eine Tradition – zu denken ist etwa an Nietzsche, Freud, aber auch Erikson. Heute scheint bei der Thematisierung der inneren Heterogenität und Unabgeschlossenheit des Subjekts neben einer deskriptiven Dimension aber auch eine normative Dimension eine Rolle zu spielen. Ein Subjekt kann gar nicht anders als konstitutiv plural und offen zu sein, diese Eigenschaften sind darüber hinaus aber auch wünschenswert. Sie stellen eine Befreiung von fixierten sozialen Zuschreibungen und deren Verinnerlichung dar.

Dabei sollte jedoch nicht überblendet werden, dass die Zerrissenheit des Selbst durchaus auch pathische Züge haben kann. Pathisch, nicht verstanden als eine individuell-psychologische Erkrankung, sondern als Leidenserfahrung, die ihren Bezugspunkt in den sozialen Verhältnissen hat. Dies redet nun keinesfalls einer Rückkehr zu einem holistischen und harmonistischen Subjektverständnis das Wort. Neben der allgemeinen Feststellung der Brüchigkeit und Gebrochenheit des Subjekts macht es jedoch dessen durchaus ambivalenten Folgen geltend, die Befreiung und Scheitern zugleich ermöglichen.
An eine solche konkrete Leidensdimension des Zerrissenen Selbst und seiner Geschichte, gemahnt Ramón Sender Barayóns Buch Ein Tod in Zamora. Changierend zwischen Erzählung und Bericht, rekonstruiert Sender Barayón hier das Leben – und vor allem den Tod – seiner Mutter Amparo Barayón, die 1936 von den spanischen Faschisten in ihrer Heimatstadt Zamora ermordet wurde. Während sie dort Schutz bei ihrer Familie suchte, wurde sie von ihrem Schwager denunziert. Insbesondere ihre Ehe mit dem antifaschistischen Schriftsteller Ramón J. Sender machte Sie zur Zielscheibe der putschenden Militärs und ihrer Gehilfen. Dass diese Ehe nicht kirchlich vollzogen wurde, reichte zudem für die Anfeindung durch die katholische Kirche, die eng mit den spanischen Faschisten verbandelt war.
Würde man Ein Tod in Zamora jedoch nur als Biographie Amparo Barayóns lesen, so entginge einem ein ganz wesentliches Element des Buches. Geschrieben ist es in einer doppelten Zeitlichkeit, in gewisser Weise rekonstruiert es mit dem Leben Amparo Barayóns immer zugleich auch diese Rekonstruktion – ihren Prozess und ihre Hindernisse – selbst. Denn Teil der erzählten Geschichte ist unabblendbar auch deren Nachgeschichte des Schweigens. Nur so wird die ständige Präsenz des Autors verständlich. Denn letztlich geht es um ihn, um die (Re-)Konstruktion seiner Selbst aus den Fragmenten der Vergangenheit und die Widerstände, an denen diese sich abarbeiten muss. Er weiß zunächst nichts von dem, was seiner Mutter widerfahren ist. Sein Vater verweigert sich nicht nur, auf die fiktionalisierten Beschreibungen seiner Romane verweisend, den Auskunftsersuchen. Er verhindert sogar das Sprechen anderer – ihm zuliebe verweigern sich Sender Barayóns Verwandte seinem Wunsch, mehr über Leben und Tod seiner Mutter zu erfahren.
So ist es letztlich ein weiterer Tod, der ihm erlaubt sich dem Leben seiner Mutter, und damit einem abgetrennten Bereich seiner Biographie, zuzuwenden. Erst nach dem sein Vater verstorben ist, eröffnet sich die Möglichkeit des Sprechens über seine Mutter – und des Zuhörens. Sender Barayón reist nach Spanien, spricht mit Verwandten, befragt Bekannte der Mutter, versucht auch von den Hinterbliebenen der Täter weitere Details zu erfahren, und rekonstruiert so das Leben von Amparo Barayón, die Umstände ihrer Inhaftierung, Folter, Ermordung und letztlich auch den Umgang mit ihrem Tod.
Tritt zu Beginn des Buches vor allem Sender Barayóns Vater als Figur auf, die den Blick auf die (eigene) Geschichte versperrt, so wird weiter jedoch deutlich, dass das Schweigen nicht nur dem persönlichen Unwillen geschuldet ist, zur Vergangenheit zurückzukehren – ob aus Schuld oder Gram. Vielmehr wird hinter dem vom Vater geworfenen Schatten ein strukturelles Schweigen sichtbar, wie es den Umgang mit den Opfern des spanischen Faschismus insbesondere kennzeichnet: Aufarbeitung‘ fand hier nicht nur aufgrund des siegreichen Franquismus keinen Raum, auch die transición, der Übergang von Faschismus zur Demokratie, hat – da explizit keine radikale Abkehr vom vorherigen Staat – die Zurichtung und Abblendung der Geschichte (und Geschichtsschreibung) weitgehend unangetastet gelassen.
Neben die Gewalt der geschichtlichen Ereignisses tritt so die Verdrängung der Trauer, die das Leiden gerade dadurch verlängert, dass sie seinem Ursprung ausblendet. Die Rückkehr zum Leiden ist bei Sender Barayón also zugleich ein psychohistorischer Heilungsprozess. Mit der Rekonstruktion des Lebens und der Ermordung seiner Mutter, findet zugleich ein ‚Sammlung‘ des Selbst statt, in der die verstreuten und verborgenen Aspekte der eigenen Biographie zusammengetragen werden.
Die so rekonstruierte Geschichte, verschmilzt dabei ihrerseits nicht wieder zu einer Einheit, sondern sie trägt die Spuren ihrer Versprengung. Dies wird nicht zuletzt in der Form des Buches, seiner sprachlichen Gestaltung sichtbar. Während Sender Barayón nicht vor detaillierten Erzählpassagen mit lebendigen Details zurückschreckt, kommt doch kein einheitlicher übergreifender Erzählfluss zustande. Immer wieder sind dem Text längere Zitate aus den Werken seines Vaters eingefügt, die mal mehr mal weniger deutlich als fiktionalisierte Schilderungen einzelner Episoden übersetzt werden. Zudem wird das Wort immer wieder an aufgesuchte Personen übergeben, ergänzt durch Passagen aus Briefen. Dabei zieht sich Sender Barayón weitgehend zurück. Die Rede der Anderen wird lediglich durch ein prosaisches Aufrufen ihrer (Vor-)Namen eingeführt, die dem Texte jede literarische Anmutung nimmt und an einen bloßen Bericht, ja ein Protokoll erinnert. So bleibt im Resultat der Rekonstruktion deren Konstruiertheit sichtbar. An ihrem Ende steht keine absolute, also perspektivlose, Wahrheit – sehr wohl aber eine weitgehende Einsicht in das Geschehene, plausibleres und weniger plausibles, eine Vernehmbarkeit des Verschwiegenen, also keineswegs ein bloßer Relativismus.
Man mag diese Form auch rückbeziehen auf die zugleich verhandelte Rekonstruktion des Selbst. Diese ist abzugrenzen von allzu naiven Vorstellung einer Heilung des Selbst hin auf eine harmonische Einheit. Am Ende steht hier weder eine ‚Selbstfindung‘ noch die Versöhnung mit der Vergangenheit als eine Versöhnung mit sich selbst. So wie die Rekonstruktion der Geschichte nicht auf einen absoluten Grund trifft, so wenig lässt sich in der Zuwendung zur Vergangenheit ein einheitliches Subjekt finden. Das Subjekt bildet sich weniger in der biographischen Vervollständigung, als im Umgang mit der Erfahrung, für das ein biographisches und geschichtliches Verstehen hilfreich sein kann. Dabei wäre eine konkrete Zerrissenheit des Subjekt weder im Namen allgemeiner Konzepte als unhintergehbare Faktizität zu hypostasieren noch gelingende Subjektivität am absoluten Ideal der harmonischen Einheit zu bemessen. So steht am Ende der Rekonstruktion kein kathartisches Ereignis, keine heilende Einsicht. Dies mag bei der Leser*in zunächst ein Gefühl des Unbefriedigenden zurücklassen. Letztlich ist es wohl aber gerade dieser verweigerte Abschluss als Abschließung, der dem Umgang mit dem Vergangenen und seiner Relevanz für die Selbst-Bildung angemessen ist.
Literaturangaben
Sender Barayón, Ramón 2000 [1989]: Ein Tod in Zamora, München: P. Kirchheim.