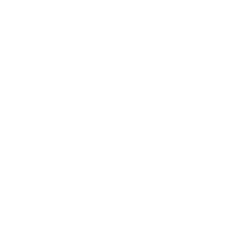Der gegenwärtige Kapitalismus produziert – so eine gängige Einschätzung – „Überflüssige“. Menschen, die, wenn man so will, rechtlich inkludiert sind: „Vollbürger“, denen formal weitgehende Rechte zukommen, zugleich aber ökonomisch (in im Kapitalismus damit auch weitegehend gesellschaftlich) exkludiert (vgl. Lemke 2007: 80 f.). Im politischen Diskurs werden diese Menschen weitgehend als Kosten verhandelt. Um für Sozialleistungen zu senken, gelte es, sie zu „aktivieren“ (Bude 2008: 27 ff.). Dabei werden die Gründe für die Lage, in der sich diese Menschen befinden, weitgehend individualisiert – da wo die „Aktivierung“ und „Mobilisierung“ nicht von Erfolg gekrönt ist, ist es ihre eigene Schuld. Folgerichtig ist das naheliegende Mittel im behördlichen Umgang mit diese „Restkategorie“ (Bude 2008: 28) die Sanktion. Beispielhaft hierfür sind die Hartz IV-Gesetze.
„Perlen vor die Säue – die „Überflüssigen“ und gesellschaftliches Potential“ weiterlesenVier Thesen zur Psychodynamik des Social Distancing – von Freude, Frust und Aggression
Gegenwärtig gibt es einen emotional aufgeladenen Diskurs um den Umgang mit Social Distancing. Einerseits kann eine moralisierende Abwertung „unsolidarischer“ Nah-Sozialität ausgemacht werden, andererseits wird auch wiederum die Reaktion auf diese kritisiert, in dem z. B. eine Tendenz zur Denunziation ausgemacht wird. In diese Wiedersprüche fühle ich mich selbst unmittelbar versetzt. Immer wieder ärgere ich mich. Bei Menschen, die meine Bemühungen Abstand zu halten mit der konsequenten Nutzung der Mitte des Bürgersteigs quittieren – so dass ich im Zweifel auf die Straße ausweichen müsste. Bei der Beobachtung einer kleineren Gruppe grillender Menschen – während ich selbst mir am Oster-Wochenende einen Besuch bei meiner Mutter versage. Ich möchte diese emotionale Selbstbeobachtungen als Anlass für ein paar Grundlegende Überlegungen zur Psychodynamik des Social Distancing nehmen, die uns wohl noch einige Zeit begleiten wird.
„Vier Thesen zur Psychodynamik des Social Distancing – von Freude, Frust und Aggression“ weiterlesenÜber den „Schutz“ von Grenzen und den Schutz von Menschen
Am vierten Februar habe ich den EU-Abgeordneten aus meiner Region geschrieben und sie gebeten sich für den Schutz der Geflüchteten und Helfer an der griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln einzusetzen. Auf die Antwort von Sabine Verheyen (CDU) habe ich eine längere Erwiderung geschrieben, die einige Punkte aus der aktuellen Diskussion anspricht, die mir auch allgemeiner relevant zu sein scheinen. Die Nachricht von Frau Verheyen, auf die ich mich beziehe, und ihre Reaktion auf meine Antwort, findet ihr unten in diesem Post.
Sehr geehrte Frau Verheyen,
vielen Dank für ihre ausführliche Antwort. In einigen Punkten lässt mich diese jedoch sehr unbefriedigt zurück.
Erst einmal bin ich froh, dass auch Sie die Situation an der griechischen Grenze aber auch auf den griechischen Inseln (davon sprach ich ja auch) als untragbar empfinden.
Was ich weniger gut nachvollziehen kann, ist, (1) das Problem ursächlich beim türkischen Staat zu sehen. Dieser spielt sicher ein wichtige Rolle, aber man wird wohl fragen müssen, ob es ursprünglich eine gute Idee war, zu meinen, sich Asylsuchende durch einen Deal mit der Türkei vom Hals zu halten. Das Taktieren auf türkischer Seite kann wohl in nicht unerheblichem Maße als Folgeproblem dieses Versuches verstanden werden. Dass die Türkei finanziell, logistisch, aber auch gesellschaftlich besser in der Lage sein sollte, diese Geflüchteten primär aufzunehmen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
„Über den „Schutz“ von Grenzen und den Schutz von Menschen“ weiterlesenLob der Kapitalismuskritik – oder: warum eine Kapitalismusfolgenkritik nicht ausreicht
Kapitalismuskritik fristet heute ein paradoxes Dasein. Einerseits erfreut sie sich als grobe und handfertige Universalerklärung allen Übels großer Beliebtheit. Andererseits wird sie als blinder und vielleicht auch impotenter Radikalismus zugunsten sozialtechnologischer Lösungen zurückgewiesen. Dass sie aber zwischen diesen Polen auch heute eine Berechtigung hat, wird deutlich, wenn man sich die konkrete Beschränktheit im Umgang mit vielen gesellschaftlichen Herausforderungen anschaut. Auch aus linker Perspektive, verbleibt Kritik oft im Status der Kapitalismusfolgenkritik. In einer solchen werden kapitalismusspezifische Zusammenhänge und ‚Gesetze‘ als selbstverständlich und unhinterfragbar hingenommen. So werden nicht die sozialen Mechanismen kritisiert, die das Feld politische Handlungsmöglichkeiten in seiner gegeben Form hervorbringen. Stattdessen bleiben Proteste häufig in dem durch diese Mechanismen eingesetzten Verhängnis verfangen. Hier kommt ein klassisches Motiv der Kapitalismuskritik zur Geltung: Der Kapitalismus ist eine Verhängnismaschine – oder, wenn man so will, zeitgemäßer, ein Verhängnisalgorithmus. Er lässt als notwendig erscheinen, was historisch kontingent hervorgebracht ist, und knotet uns somit an die gegebenen Umstände. Eine kapitalismuskritische Perspektive drängt sich also immer dann auf, wenn Folgen politischen Handelns durch scheinbar unhintergehbare Gesetze begründet werden.
„Lob der Kapitalismuskritik – oder: warum eine Kapitalismusfolgenkritik nicht ausreicht“ weiterlesenWalter Benjamin und die Revolution des Diskurses
Walter Benjamins Essay Der Autor als Produzent, in dem sich Benjamin Mitte der 1930er Jahre kritisch mit politischer Literatur auseinandersetzt und fordert, Autor*innen weniger von ihrer inhaltlichen Positionierung zu den Produktions- und Klassenverhältnissen aus zu verstehen als vielmehr von ihrer Stellung in diesen (Benjamin 2001), lässt sich auch als ein Beitrag zur Diskurstheorie lesen.
„Walter Benjamin und die Revolution des Diskurses“ weiterlesenJuvenile Briefpraktiken der frühen 2000er – Ein persönliches Erinnerungsbild
Die Freude von Zufallsfunden. Gerade habe ich einen Brief einer französischen Brieffreundin aus dem Jahr 2006 zufällig hinten in einem alten Adressbuch gefunden. Dieser Brief ergänzt einen Fund von vergangenem Jahr: eine Box mit Zetteln und Briefen vom Anfang der 2000er. An den Briefen scheint die eigene Jugend zu heften, bzw. deren Milieu – da ja nur die Worte der anderen, die Antworten auf das eigene Erhalten ist. Aus ihnen spricht viel Liebeskummer und Unsicherheit, wer man ist; die Suche nach Bestätigung und Anerkennung. Aber auch viel Langeweile: in der Schule, zu Hause, bei Hausarrest.
„Juvenile Briefpraktiken der frühen 2000er – Ein persönliches Erinnerungsbild“ weiterlesenJenseits des Diskurses? Diskursives, Nicht-Diskursives und die politische Praxis der Forschung
Silke van Dyk et al. problematisieren in ihrem als fiktives Gespräch inszeniertem Beitrag über das „Jenseits des Diskurses“ eine dichotomische Entgegensetzung von Diskursivem und Nicht-Diskursivem. Diese sei in der CDA, etwa bei Norman Fairclough, zu finden, die den Diskurs in einen vorgängigen Realität der Klassengesellschaft verortet. Aber auch die Dispositivanalyse nach Bührmann und Schneider tendiert zu einem Dualismus, indem dem Diskurs allerlei Nicht-Diskursives Beigestellt wird (van Dyk et al. 2014: 348, 354 f.).
„Jenseits des Diskurses? Diskursives, Nicht-Diskursives und die politische Praxis der Forschung“ weiterlesenDiskursive Autorität und Unfehlbarkeit – Trump und die „Never Trumpers“
Es steht schlecht um den US-amerikanischen Präsidenten. Folgt man den Aussagen der letzte Woche öffentlich gegangenen Amtsenthebungsverfahrens (genauer eigentlich: den parlamentarischen Vorermittlungen dazu, ob ein solches Verfahren formal durchgeführt werden soll), so deutet alles darauf hin, dass Donald Trump staatliche Mittel zur militärischen Unterstützung der Ukraine missbraucht hat, um vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönliche politische Gefälligkeiten zu erpressen. Insbesondere sollte die dieser – rechten Verschwörungstheorien folgend – die Untersuchung einer vermeintlichen Einmischung der Ukraine in die US-Wahlen 2016 einerseits und Ermittlungen gegen den ehemaligen Vize-Präsidenten und aktuellen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn öffentlich ankündigen. Vor allem letzteres ist Stein des Anstoßes, weil Trump hier die US-Außenpolitik für den Angriff auf einen innenpolitischen Gegner nutzt – und das heißt auch: einen anderen Staat zur Beeinflussung des amerikanischen Wahlprozesses auffordert.
„Diskursive Autorität und Unfehlbarkeit – Trump und die „Never Trumpers““ weiterlesenVon Subjektposition zu Subjekträumen – Überlegungen zum Verhältnis von Diskurs und Subjekt
In strukturalistischer Tradition geht die französische Diskursanalyse davon aus, dass Subjekte dem Diskurs nicht zugrunde liegen, sondern von diesem allererst erzeugt werden (vgl. Angermuller 2014: 138). In diesem Kontext ist von „Subjektpositionen“ die Rede. Und während diese als zu starre Konzeption der diskursiven Hervorbringungen und Determinierung des Subjekts kritisiert werden (vgl. Schatzki 2002: 194 ff.), so ist doch die Plausibilität dessen nicht abzustreiten, dass wir nicht aus freien Stücken sprechen; dass – um gehört und ernstgenommen zu werden – wir einen Ort im Diskurs adaptieren müssen. Gerade aus diesem Sachverhalt entsteht ja eine ganze Reihe an Ambivalenzen kritischer Interventionen in den Diskurs, da diese, um wirksam werden zu können, in gewisser Weise immer auch ein Stück weit dazu genötigt werden, das kritisierte zu stützen. Im Diesseits, so könnte man zuspitzen, lässt sich nicht von einem Nicht-Ort, einem ou-topos aus sprechen, in dem die gegenwärtigen Verhältnisse schon überwunden wären.
„Von Subjektposition zu Subjekträumen – Überlegungen zum Verhältnis von Diskurs und Subjekt“ weiterlesenIdeologiekritik und Hegemonie – zu einem ambivalenten Verhältnis
Interessanter als die Kritik der Dominanz der hegemonialen kulturellen Ordnung ist für eine Ideologiekritik vermutlich: zu sondieren, inwieweit sich an ihren Rändern, in Sub- und Gegenkulturen vermittelt eine Affirmation jener hegemonialen Ordnung ausmachen lassen, oder aber Momente einer wirklichen utopischen Alterität aufscheinen. Darüber hinaus finden sich aber zwei weitere nicht-triviale Optionen, Optionen also die also eine bloße Bestätigung der vorgewussten Ablehnung des herrschenden Wissens überschreiten, die zugleich aber das Terrain einer Ideologiekritik erheblich verkomplizieren: Das Aufweisen widerspenstiger Momente innerhalb der hegemonialen Ordnung einerseits. Und andererseits: die Möglichkeit einer dystopischen Alterität in Gegenkulturen zu erspüren. Letzteres hat seine Dringlichkeit insbesondere, seit der Faschismus des 20. Jh. endgültig den Glauben an garantierten Fortschritt der Menschheit zerstört hat.
„Ideologiekritik und Hegemonie – zu einem ambivalenten Verhältnis“ weiterlesen