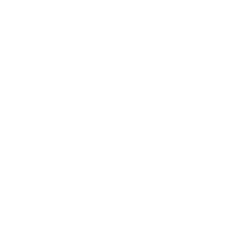In einem jüngst im Merkur erschienen Auszug aus seinem neuen Buch „Der arbeitende Souverän“ setzt sich Axel Honneth aus einer sozialtheoretischen Perspektive kritisch mit dem Anliegen der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auseinander. Dabei weist er die Annahme zurück, dass das bedingungslose Grundeinkommen die Demokratisierung stärke, indem es mehr Freiraum für politischen Engagement schafft. Honneth sieht die Arbeitsbeziehungen als eine Voraussetzung für die politische Vergesellschaftung. Darum wendet er sich gegen den Versuch, Demokratisierung möglichst von der Arbeitswelt zu entkoppeln und plädiert stattdessen für eine Demokratisierung der Arbeitswelt selbst, als Grundlage kollektiver demokratischer Praxis.
Zentral für Honneths Argumentation ist, dass die Arbeitswelt durch Arbeitsteilung gekennzeichnet ist. Die Arbeitsteilung zwinge die Arbeitenden in Sozialverhältnisse, die über private Präferenzen hinausgehen. Genau darin sieht Honneth eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung gemeinsamen politischen Engagements (Honneth 2023: 52 ff.)
Diese Konstruktion ist insbesondere dann bemerkenswert, wenn man sich die Ansätze der klassischen Kritischen Theorie ins Gedächtnis ruft. So kann man erstens Honneths Verständnis von Arbeitsteilung als Quelle gesellschaftlicher Integration in gewisser Weise als Anti-Lukács gelesen werden. Bei Georg Lukács ist Arbeitsteilung ja die Grundlage der Entfremdung und Verdinglichung, die es für ihn zu überwinden gilt (Lukács 1968).
Genau dieser Aspekt des Lukács’schen Denkens ist immer wieder kritisch diskutiert worden. Inwiefern lässt sich eine moderne Gesellschaft ohne Arbeitsteilung denken? Führt dies nicht ungewollt zu einer ökonomischen und politischen Regression? Aber so kritisch die Vorstellung der Abschaffung von Arbeitsteilung ist, so auffällig ist wiederum, dass sie bei Honneth ungetrübt von jeglichem negativen gesellschaftlichen Effekt erscheint.
Damit zusammenhängend, ist es zweitens bemerkenswert, wie unbekümmert Honneth den Zwangscharakter der durch Arbeitsteilung aufgenötigten sozialen Integration beschreibt. Er spricht hier explizit von der Angewiesenheit der Einzelnen von der Gesellschaft und vom Zwang, jenseits des eigenen Willens und familiärer (gemeinschaftlicher) Zusammenhänge in Kontakt mit anderen zu treten. Aber ist dieser Zwang so völlig ohne jede Nähe, zu dem Zwang der Unterordnung des einzelnen in der Gesellschaft, die Adorno immer wieder kritisiert hat? Auch hier scheint mir weniger die Tatsache das Problem, dass Honneth die vergesellschaftlichende Dimension von Erwerbsarbeitsverhältnissen hervorhebt. Diese ist ohne Frage bedeutend. Aber es verwundert doch die Abblendung jeglicher Ambivalenz dieser sozialen Prozesse oder, wenn man so will, ihr undialektisches Verständnis. Statt einer Kritik, die es sich nicht zu einfach machen will, und darum herausstellt, was von alternativen Sozial- und Arbeitsverhältnissen erst einmal zu leisten wäre, erscheint hier das Sosein von Arbeit selbst als unübersteigbare Lösung und wird so tendenziell ins Affirmative gewendet.
Das wird u. a. auch dann sichtbar, wenn Honneth von Arbeit spricht und den Beziehungen, in denen sie vollzogen wird, und dabei implizit immer Lohnarbeit zu meinen scheint, die er im selben Zug aber mit gesellschaftlicher Produktivität überhaupt gleichsetzt. Besonders irritierend ist, dass er explizit (wenn auch in Anführungszeichen) den Begriff des Parasitären benutzt, wenn er von der Gefahr spricht, dass jemand es bei bedingungslosem Grundeinkommen vorziehen könnte, nicht zu arbeiten und damit von den Steuerzahlungen anderer lebte, „die weiterhin zur Erwerbsarbeit (sic!) bereit wären“ (Honneth 2023: 52 f.).
Bei seinem Insistieren auf der Veraussetung demokratischer Vergesellschaftung in den Erfahrungen der Arbeitswelt setzt Honneth damit letztlich selbst ein ideologisches Arbeitsverständnis voraus, das nicht in der feministischer Ökonomiekritik bereits seit Jahrzehnten grundlegend dekonstruiert worden ist (Mader/Schultheiss 2011: S. 416–419). Überraschenderweise orientiert sich hier wohl weniger an Arbeit selbst in ihrer empirischen Mannigfaltigkeit als an einer gesellschaftlich dominanten Vorstellung von Arbeit. Das wird u. a. deutlich, wenn es um die von dieser Arbeit Ausgeschlossenen geht.
„Denjenigen hingegen, die sich als vollkommen überflüssig empfinden müssen, weil sie ohne sozial anerkannte Beschäftigung sind, wird es an jedem Impuls fehlen, an diesen Beratungen [der öffentlichen Willensbildung, D.A.] mitzuwirken, da sie kein Sensorium für die Mitgliedschaft in einem Gemeinwesen entwickeln können“ (Honneth 2023: 54).
Die faktischen Effekte der Arbeitslosigkeit, auf die sich Honneth in diesem Zusammenhang bezieht, sind gar nicht zu bestreiten, er scheint diese aber zu naturalisieren. Und damit blendet er ab, dass es ja gerade auch ein Anliegen der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen ist, die soziale Anerkennungsordnung der Arbeit – die Honneth hier als Gegeben voraussetzt – zu hinterfragen und damit gesellschaftliche produktive Arbeit zu ermöglichen, die in den gegenwärtigen Entlohnungsverhältnissen unter den Tisch fallen.
In gewisser Weise ist es in für Honneths Argumentation durchaus passend, dass er Arbeit auf eine bestimmte Form der Lohnarbeit einschränkt. Denn damit werden gerade die Arbeitsverhältnisse abgeblendet, die sich seiner Erzählung von der Arbeitswelt als großer quasi-öffentlicher Inklusionsinstitution der Gesellschaft schwer einfügen. Die klassische Hausarbeit ist etwa durchaus in die gesellschaftliche Arbeitsteilung eingebunden – ohne dadurch aber darum schon Motor einer Vergesellschaftung jenseits der familiären Verbindungen oder gar der Gemeinschaft zu sein.
Mit all dem möchte ich nicht in Abrede stellen, dass Arbeitsverhältnisse ein gesellschaftlich maßgebliches Feld der Kreuzung sozialer Kreise ist. Aber Honneth scheint dabei diesen Charakter der Arbeitssphäre in überhöhender Weise zuzusprechen und andererseits anderen Institutionen der Gesellschaft weitgehend abzusprechen. So ist ja nicht zu vergessen, dass Arbeitsverhältnisse keinesfalls von sozialer Fremd- und Selbst-Selektivität befreit sind (man arbeite zum Test nur einmal in einer PR-Agentur – oder auch einfach einer Universität). Zudem scheint Honneth in seiner Argumentation Unternehmen zu quasi-öffentlichen Einrichtungen zu erheben, während er zugleich anderen Institutionen, wie etwa Vereinen, Vergemeinschaftungsfunktionen abspricht, indem er sie als „privat“ kennzeichnet (Honneth 2023: 56).
Wenn Honneth zum Ende des Textes für eine „Demokratisierung der gegebenen Arbeitsverhältnisse“ plädiert, so ist dies sicher nur zu unterstützen. Das ersetzt aber nicht eine tiefer Ansetzende Kritik der Rolle von Arbeit in der Gesellschaft. So lässt sich die skandalöse Kopplung gesellschaftlicher und politischer Teilhabe an eine Erwerbsbeschäftigung, wie Honneth sie selbst ja anspricht, kaum allein mit einer Demokratisierung von Unternehmen (und vage in Aussicht gestellter Vollbeschäftigung?) beheben. Und in der Vehemenz, mit der Honneth die Arbeitswelt (als Erfahrungswelt aber auch als gesellschaftlich Imaginäres) zur Voraussetzung demokratischer Politik macht, droht er letztlich diese Arbeitsverhältnisse zu zementieren.
Trotz dieser Kritik halte ich die Frage, die die Honneth aufwirft, tatsächlich für sehr wichtig: welche Vergesellschaftungsinstitutionen setzt eine auf breite Partizipation abzielende Demokratie voraus. Mein Impuls wäre hier aber nicht auf eine singuläre Institution zu setzen, sondern nach den mannigfaltigen Arenen fragen, in denen sich Vergesellschaftung vollzieht – Vergesellschaftung verstanden als fortlaufende Entwicklung von transversalen sozialen Beziehungen jenseits bloßer „Gemeinschaft“ oder enger sozialer Kreise und, damit zusammenhängend, als Entstehung eines politischen Gemeinwohls. Neben der Arbeitsbeziehungen nennt Honneth selbst die Schule als gesellschaftliche Institution, in der Gesellschaft sich aus Überschreitung der Vergemeinschaftung konstituiert, ohne hierauf jedoch ausführlicher einzugehen. Dem wären weitere Bildungsinstitutionen (wie etwa Familienbildungszentren) beizustellen, die jeweils nicht nur Orte der Vergesellschaftung von Kindern, sondern immer auch deren Eltern sind. Entsprechende Erfahrungen konnte ich z. B. in dem Projekt „Gemeinsam. Demokratisch. Wachsen. – Eltern als Partner*innen der Demokratieförderung“ machen. Aber, wie man dies auch immer bewerten mag, auch Sportvereine und Glaubensgemeinschaften wirken hier in diesem Sinne vergesellschaftend. Und bei ihnen kann man ebenso wie im Fall der Arbeitsverhältnisse fragen, welche Schattenseiten und paradoxen Effekte mit ihrer jeweiligen Vergesellschaftungsfunktion einhergehen. Der Vorteil wäre bei einer solchen Perspektive darin, dass sie nicht einfach mit der anthropologischen Unterstellung eines inneren Drangs des Menschen zur politischen Auseinandersetzung einsetzen muss, wie es vielleicht in manchen Laiensozialtheorien von Vertreter*innen eines bedingungslosen Grundeinkommens der Fall ist, zugleich aber eine größere Offenheit hinsichtlich der Frage hat, welche sozialontologischen Voraussetzungen demokratische Vergemeinschaftung hat.
Literatur:
Honneth, Axel 2023: Politiken der Arbeit, Merkur, 77, 886, S. 49–57.
Lukács, Georg 1968: Geschichte und Klassenbewußtsein, Neuwied: Luchterhand.
Mader, Katharina/Schultheiss, Jana 2011: Feministische Ökonomie – Antworten auf die herrschende Wirtschaftswissenschaften? PROKLA, 41, 3, S. 405–422.