Bericht zur Veranstaltung: Soziologie als Beruf – zwischen gesellschaftlicher Relevanz und Prekarität, DGS Kongress, Bielefeld, 29.9.2022, 19–21 Uhr.
Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind kein Nischenthema mehr. Ihre Thematisierung gehört inzwischen zum guten Standard großer Fachkonferenzen. In der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wird dieses Thema inzwischen dauerhaft vom Ausschuss „Soziologie als Beruf“ bearbeitet. Auf dem diesjährigen DGS-Kongress haben Heike Delitz, Birgit Blättel-Mink, Ina Krause, Cedric Jürgensen, Nina Weimann-Sandig, Paul Sinzig und Sebastian W. Hoggenmüller für den Ausschuss die Veranstaltung „Soziologie als Beruf – zwischen gesellschaftlicher Relevanz und Prekarität“ organisiert. Trotz der späten Stunde nach einem langen Konferenztag, konnte sich die Veranstaltung über ein reges Interesse freuen. Der Altersschnitt legt nahe, dass sich leider allerdings wenige Professor*innen in die Veranstaltung verirrt haben. Trotz der dauerhaften Verankerung des Themas in den Gremien der DGS, scheint hier noch einige Arbeit nötig zu sein, damit es nicht nur als spezifisches Interesse des „Nachwuchses“ aufgefasst wird, sondern als Thema, dass in der Gestaltung der Bedingungen soziologischer Forschung und Lehre für alle Soziolog*innen mittelbar relevant ist.
Genau diesen Punkt hat Tilman Reitz (Friedrich-Schiller-Universität Jena), der von den Organisator*innen als Moderator gewonnen werden konnte, zum Ausgangspunkt genommen. Er verwies darauf, dass prekäre Beschäftigungsbedingungen auch auf die Qualität der Forschung auswirken, etwa wenn finanzieller und zeitlicher Druck und Abhängigkeitsstrukturen zum Fälschen und Verschweigen von Ergebnissen führen. Zur aktuellen Entwicklung konstatierte er, dass die mit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) von 2016 versprochen Verbesserungen nicht eingetreten sein. Dabei lägen durchaus solide Modelle für einen grundlegenden Wandel der Gestaltung von akademischen Personalmodellen vor: Etwa von der Jungen Akademie und vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft.
Kristin Eichhorn (Universität Stuttgart) knüpfte hieran an, indem sie auf einige Vorschläge verwiese, die im Zuge der Twitter-Kampagnen #95vsWissZeitVG und #IchBinHanna, die Sie mitinitiiert hat, diskutiert wurden. Neben der Forderung einer Mindestvertragslaufzeiten von vier Jahren und vollen Stellen für Vollzeitarbeit, verwies sie auf die Notwendigkeit den Qualifikationsbegriff zu präzisieren und auf die Promotionsphase zu begrenzen. Eine Sonderbefristung über das Wissenschaftszeitvertragsgesetzt (WissZeitVG) für die Postdoc-Phase sei hingegen abzuschaffen.
Roland Bloch vom Zentrum für Schul- und Hochschulbildung in Halle steuerte einen empirischen Blick aus der Hochschulforschung bei. Die steigende Anzahl wissenschaftlicher Beschäftigter habe nur unterdurchschnittlich zu einem Zuwachs an Professuren geführt. Bloch stellte fest, dass Spielräume aus staatlichen Programmen, wie dem Qualitätspakt Lehre, von den Universitäten nicht für die Schaffung verlässlicher Stellen genutzt wurden. Eine bewusste Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen für die Universität als Ganzes, finde kaum statt.
Bloch hob die Hochschulen als einen für Kämpfe um bessere Arbeitsbedingungen relevanten Ort hervor, was insbesondere im Vergleich zwischen Hochschulen sichtbar werde. Häufig würden prekäre Beschäftigungsverhältnisse in den Hochschulen jedoch einfach als eine extern aufgezwungene Notwendigkeit akzeptiert – wenn sie nicht sogar als wünschenswert angesehen.
Auch der bildungspolitische Blick auf die Auseinandersetzung um gute Arbeitsbedingungen war in der Veranstaltung vertreten. Zugeschaltet war Sabine Johannsen, Staatssekretärin im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Nach einem ausführlichen Lob der Soziologie im allgemeinen und ihrer Relevanz angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen, bemühte sie sich um eine Position, die irgendwie alle Seiten beschwichtigt. Sie habe „größtes Verständnis“ für das Bedürfnis einer verlässlichen Karriere. Es könne aber zugleich auch nicht Aufgabe der Wissenschaft sein, jeder Akademiker*in eine Heimat zu bieten. Am WissZeitVG lobte sie, dass es den wissenschaftlichen Organisationen Rechtssicherheit biete. Fehlentwicklungen sieht sie entsprechend nicht beim Kernanliegen des Gesetzes, sondern eher an dessen Rändern, quasi in exzessiven Auslegungen seiner Spielräume. Statt einer früheren Verlässlichkeit durch die Begrenzung befristeter und prekärer Beschäftigung, fordert sie eine „frühestmögliche“ Klarheit über Karriereoptionen. Wie das konkret aussehen soll, blieb dabei vage. Und das ist vermutlich kein Zufall. Vergessen wird, wenn man das Problem auf die Ebene der Karriereberatung herabstuft, dass die Unklarheit über Karriereoptionen strukturell verankert ist, solange wissenschaftliche Arbeit bis in die Mitte der Vierziger als „Qualifizierung“ angesehen wird, also explizit offen ist, wer geeignet ist. Zumindest fällt es schwer sich vorzustellen, wie es aussähe, wenn 80 % der Doktorand*innen nach dem ersten Jahr gesagt würde, dass sie für die Wissenschaft nicht geeignet seien.
Wiederholt aufgegriffen wurde aber ein weiterer Aspekt, den Johannsen einbrachte: Der Fokus auf Drittmittelförderungen sei ein Problem für die Einrichtung verlässlicher Stellen. Es müsse gezielt danach gesucht werden, wie, und für welche Phasen in der Karriereplanung, bei Drittmitteleinwerbungen dennoch feste Arbeitsverhältnisse ermöglicht werden.
Klaus Dörre (Friedrich-Schiller-Universität Jena) bemerkte daran anschließend, dass die Forschungsförderung in ihrer Unvorhersehbarkeit auch keine geeigneten Möglichkeiten für eine langfristige Erforschung gesellschaftlicher Transformationsprozesse bereitstelle. Die Politik müsse hier die Bedingungen für die Beforschung gesellschaftlich dringlicher Themen schaffen.
Leicht ‚optimistische‘ Töne schlug Dörre bezüglich der Entwicklung von Arbeitsbedingungen an. Der Wandel vom wissenschaftlichen Arbeitsmarkt hin zu einem Angebotsmarkt, in dem Universitäten um eine geringere Zahl geeigneter Bewerber*innen konkurrieren, die sich ihrer Alternativen bewusst sind, ändere die Realitäten und führe auch zu einem Wandeln der Anstellungsbedingungen. Letztlich plädierte er perspektivisch für die Schaffung diversifizierter Optionen innerhalb der Wissenschaft und damit auch für eine stärkere Differenzierung von Forschung und Lehre. Während die Vorgeschlagene Aufwertung von akademischer Lehre sicher wünschenswert ist, darf aber nicht übersehen werden, dass diese Differenzierung unter aktuellen Verhältnissen nicht eher zu einer gesteigerten Hierarchie als zu einer Diversität gleichwertiger Stellenausrichtungen führt. Unbefristete oder zumindest längerfristige Stellen werden vermehrt als Hochdeputationsstellen ausgeschrieben, bei denen keine Zeit für Forschung vorgesehen ist, während Forschung und Publikationen aber für die weitere Karriere die ausschlaggebenden Kriterien bleiben.
Andrea Hense vom SOFI in Göttingen, verweist auf die schädlichen Effekte der Befristung, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Organisation: Neben vermehrter Krankheit und Belastungen bleibt auch eine Identifikation mit der Institution und der Arbeit auf der Strecke.
Universitäten, so Hense, nutzen die Spielräume des WissZeitVG nicht für die Schaffung sicherer Beschäftigungsverhältnisse. Vielmehr verhindere die Verwaltung zum Teil eine langfristige Anstellung, indem sie die Regeln des WissZeitVG auch jenseits dessen Geltungsbereich auf Drittmittelprojekte anwendet.
Wie Tilman Reitz, verwies auch Hense auf die negativen Effekte von prekärer Beschäftigung auf das wissenschaftlich Arbeiten. Wissen geht verloren, wenn beständig Beschäftigungsverhältnisse abgebrochen werden, weil Kolleg*innen die Wissenschaft verlassen. Durch Unsicherheit und Druck werden viele Projekte und Publikationen verhindert, weil sie im Spiel um die Professur nicht gelten. Als positives Gegenbeispiel verweist sie auf die Erfahrungen am SOFI: Kooperativ werden besser gearbeitet. Konkret könnten auch bei Drittmittelförderung durch ein „Poolen“ der Mittel langfristige Stellen geschaffen werden, die über den Zeitrahmen einzelner Projekte hinaus gehen.
Der Veranstaltung ist es gelungen, eine Vielzahl von Perspektiven – aktivistischen, bildungswissenschaftlichen, politischen – zusammen und in Austausch zu bringen. Dabei wurde deutlich, dass, trotz größerer öffentlicher Aufmerksamkeit und vereinzelter Erfolge, auch mit der Novelle des WissZeitVG keine Maßgeblichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von Soziolog*innen jenseits der Professur zu verzeichnen sind. Einigkeit besteht wohl, dass es einen Handlungsbedarf angesichts der exzessiven, häufig auch extrem kurzen, Befristungen gibt. Wenig Einigkeit ist allerdings bei der Frage zu erwarten, welche Form nötige Veränderungen annehmen sollen. Während bei Diskutant*innen aus der Wissenschaft die Forderung nach grundsätzlichen Veränderungen inklusive eine zumindest teilweisen Abschaffung des WissZeitVG vorherrschte, scheinen die Zeichen politisch eher auf eine Nachbesserung in Randbereichen des WissZeitVG zu stehen – bei grundsätzlicher Beibehaltung von Sonderbefristungen und entgrentzten Qualifikationsphasen. Über diese Fragen hinaus, oder in gewisser Weise ‚unterhalb‘ der Ebene gesetzlicher Regelungen, waren sich die Teilnehmer*innen aber auch darin einig, dass die jeweilige Universität als Kampfplatz um Arbeitsbedingungen nicht vernachlässigt werden sollte. Hier können gegebene Spielräume für bessere Arbeitsbedingungen genutzt werden – auch das WissZeitVG verbietet ja keinesfalls unbefristete Stellen zu schaffen – oder aber im Namen von ‚Rechtssicherheit‘ oder aus ideologischen Erwägungen zur Verhinderung verlässlicher Arbeitsbedingungen.
Dass die in der Veranstaltung angesprochenen Themen für Soziolog*innen (insbesondere ohne Professur) eine unmittelbare Relevanz haben und die Veranstaltung hier Anregungen und Impulse geben konnte, wurde nicht nur in der abschließenden Diskussion deutlich, sondern auch in den vielen Gesprächen, die in der U-Bahn noch aufzuschnappen waren.

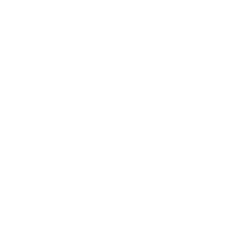
Sehr informativ, vielen, vielen Dank, David Adler!